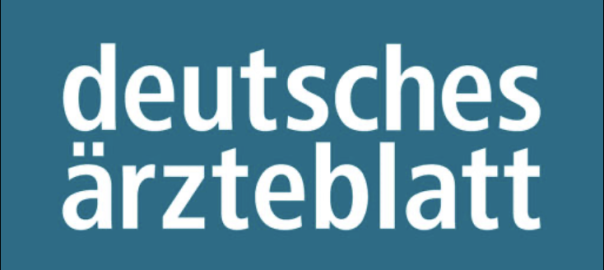Noch ist Parkinson nicht besiegt. Aber es gibt Hoffnung, dass die Wissenschaft neue Therapieansätze findet. Und auch den Ursachen der heimtückischen Krankheit – wie unter anderem chemischen Unkrautvernichtern – kommen Forschende immer mehr auf die Spur. Ein Dok zeigt auf ARTE überraschende neue Therapie- und Diagnoseansätze. Sie können den Film bis am 30.12.25 gleich hier sehen:
Morbus Parkinson – eine Diagnose, die Betroffene tief erschüttert. Denn die Schüttellähmung ist eine schleichende Erkrankung des Gehirns, bei der sämtliche Bewegungsabläufe nach und nach ins Stocken geraten und am Ende eine völlige geistige Umnachtung drohen kann. Bis heute gilt Parkinson als unheilbar.
«Viele Jahre lang haben sich Wissenschaftler nur auf das Gehirn konzentriert, darauf, wie die Neuronen absterben und wie man das aufhalten kann», erzählt Agnete Kirkeby, Neurologin an der Universität von Kopenhagen. «Aber wir haben versäumt, die Ursachen zu untersuchen.» Kirkebys Forschung wirft Licht auf einen neuen Aspekt der Entstehung von Parkinson, einer neurodegenerativen Erkrankung: Ein fehlgefaltetes Protein namens Alpha-Synuclein scheint dabei eine entscheidende Rolle zu spielen, indem es – fast wie ein Virus – im Gehirn von Nervenzelle zu Nervenzelle wandert, diese infiziert und dabei zerstört.
Ein am Universitätsklinikum Kiel entwickelter Bluttest kann dieses ansteckende Protein sogar detektieren, bevor erste Symptome beim Patienten sichtbar werden. Zusammen mit einem vielversprechenden Vakzin gegen den ansteckenden Auslöser von Parkinson könnte so der entscheidende Schritt in der Therapie von Parkinson gelingen, glaubt Daniela Berg, Professorin für Neurologie am Universitätsklinikum Kiel: «Wir gehen davon aus, dass wir in dieser frühen Phase weitere Fehlfaltungen, weitere schädliche Einflussfaktoren und auch das Fortschreiten, das Anstecken von anderen Zellen verhindern. Das wäre grossartig. Dann hätten wir den Krankheitsverlauf in einem Moment gestoppt, wo er noch gar nicht richtig angefangen hat.»